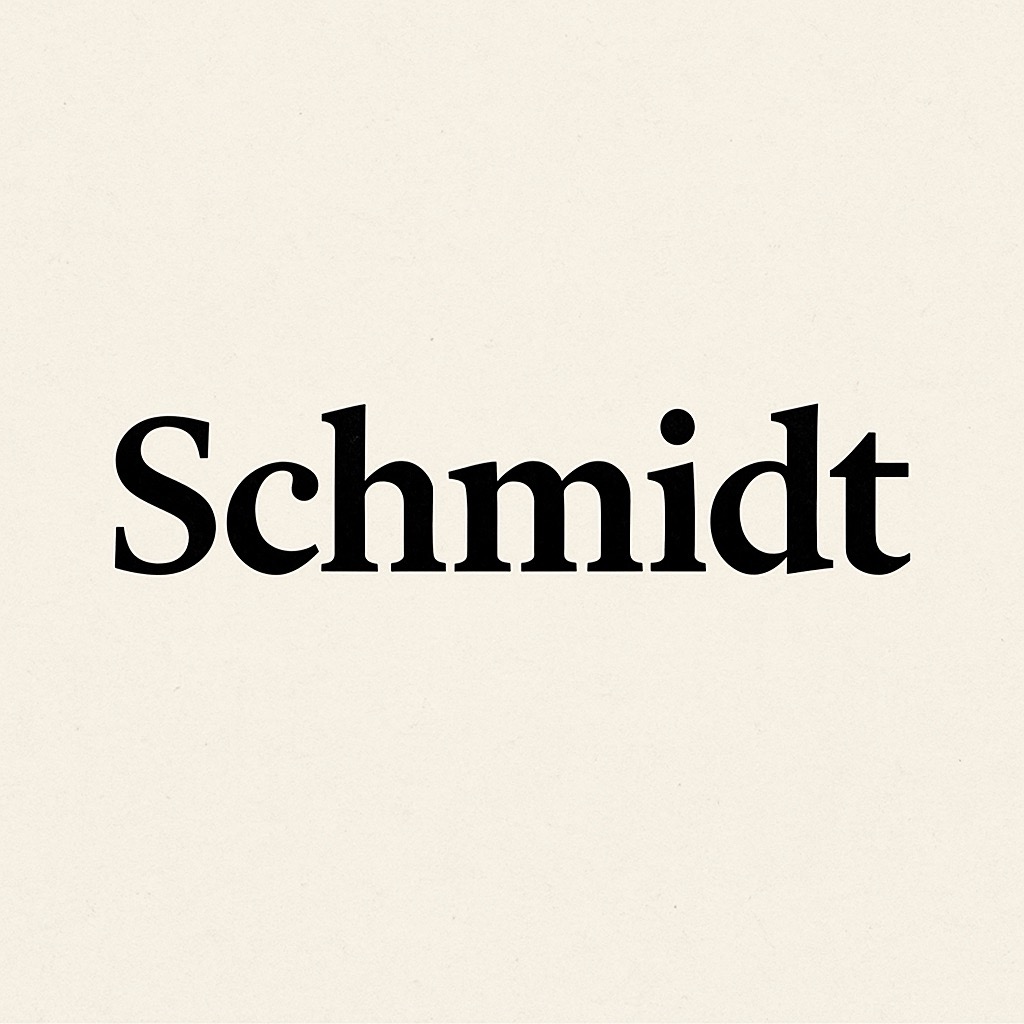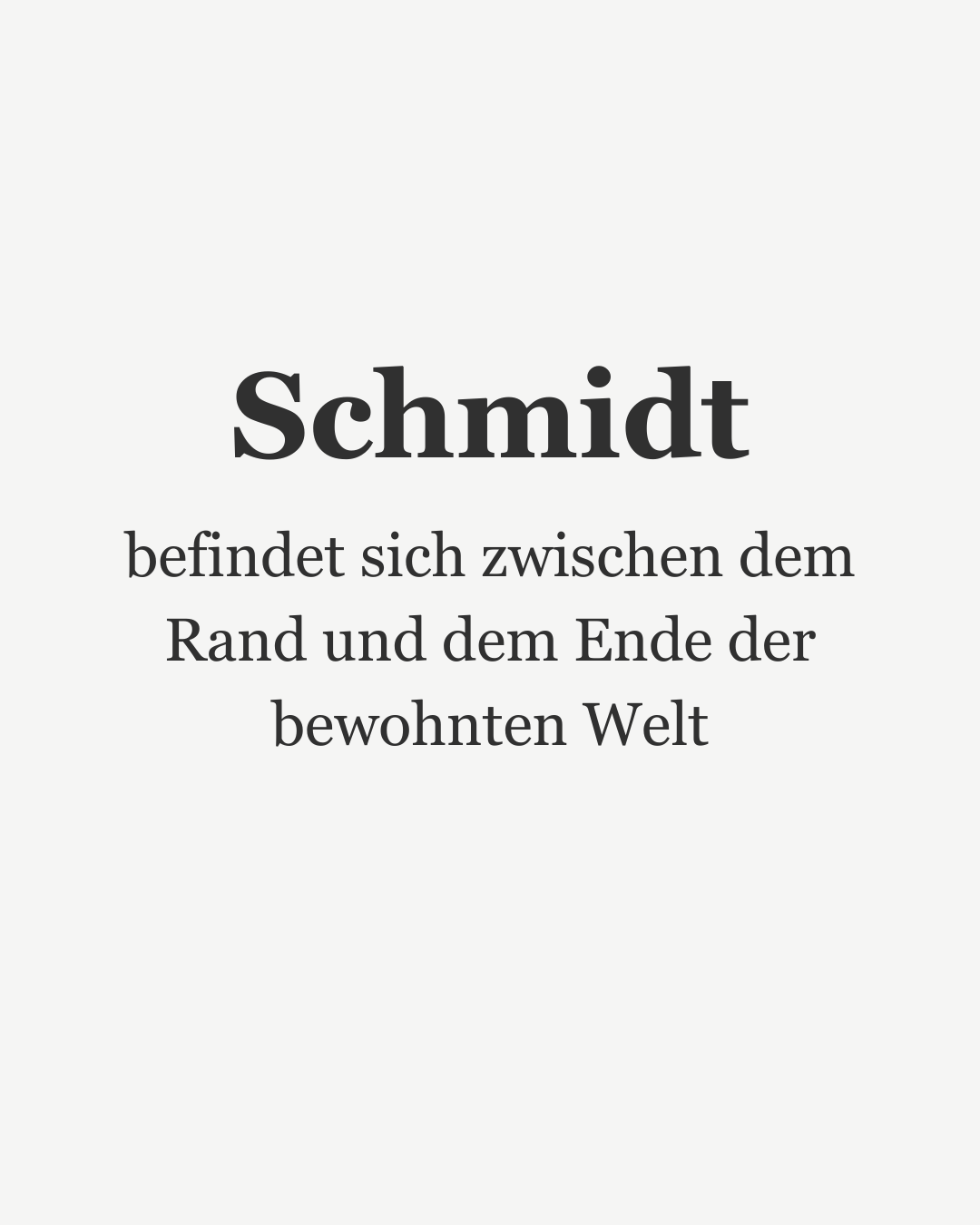Eine Sichtung
Exposition
Schmidt ist eine literarische Figur, die mich seit 2024 begleitet – manchmal mit, meistens gegen meinen Willen. Schmidt passiert mir, wie anderen das Wetter. Schmidt ist da, und man kann nichts dagegen machen.
Über Schmidt wissen wir wenig und ich selbst nichts Genaueres. Wüsste Schmidt mehr über sich, könnte er uns helfen, doch tut er weder das eine noch das andere.
Was wir wissen
Schmidt atmet regelmäßig, wobei er üblicherweise regelmäßig atmet, da Atmung viel mit dem Fortbestand physiologischer Prozesse zu tun hat. Schmidt legt seine Schlüssel auf die Kommode, wobei er seine Schlüssel üblicherweise auf die Kommode legt, da die Aufbewahrung von Schlüsseln viel mit Wiederauffindbarkeit zu tun hat. Ein Verhalten, von dem Schmidt profitiert. Schmidt beobachtet und wird beobachtet, von wem, ist unklar.
Was Schmidt nicht ist
Schmidt ist kein Protagonist, da er nichts protagonisiert. Schmidt ist keine Metapher, da er nichts bedeutet. Schmidt ist kein Konzept, da er zu konkret, und keine Person, da er zu abstrakt ist. Schmidt ist nicht lustig, obwohl andere lachen. Schmidt ist nicht traurig, obwohl er traurig macht.
Schmidts Welt ist unübersichtlich und wächst. Es existieren Fragmente, Zyklen, Beobachtungen und Situationen. Schmidt begegnet Menschen, Objekten, Ideen und sich selbst. Schmidt begegnet der Welt, und die Welt begegnet Schmidt, meist unfreiwillig.
Wäre Schmidt ein Konzept, wäre er ein schlechtes. Da aber keines ist, wollen wir in dieser Sache nicht werten. Die Frage ist nicht, wer Schmidt ist, sondern warum er ist. Und ob man etwas dagegen tun kann.
Wir sehen Schmidt, wie er an die Öffentlichkeit tritt.
I. Annäherungen
Schmidt und das neue Jahr
“Manchmal”, sagte Schmidt, “ist das beste am Neuen Jahr, dass das Alte nicht schlechter war, als man dachte.”
Schmidt und Deutschland
Schmidt steht auf und geht zum Fenster. Draußen ist Deutschland, was weder gut noch schlecht ist, sondern einfach unvermeidlich. Er öffnet das Fenster einen Spalt breit und lässt die Luft herein, die riecht wie alle Luft überall: nach nichts besonderem, aber immerhin nach etwas.
Schmidt weiß, wann es Zeit ist
Schmidt sitzt in seinem Sessel und denkt über Zeit nach. Nicht über die Zeit im physikalischen Sinne, sondern über jene Zeit, die vergeht, während man lebt, ohne zu bemerken, dass man lebt.
Er blättert durch ein Notizbuch, das er nicht geschrieben hat, aber trotzdem versteht, weil manche Geschichten universal sind, auch wenn sie nur einer erlebt hat. “Reisen”, denkt Schmidt, “ist wie Drogenkonsum für Langweiler: Man verlässt die Realität, ohne sie wirklich zu verlassen.”
Er schließt das Fenster wieder und setzt sich zurück in seinen Sessel.
Draußen regnet es, was in Deutschland normal ist.
Schmidt und die Uneindeutigkeit
Schmidts Gedanken in Bezug auf dieses Thema sind uneindeutig, was viele als Defizit empfinden, Schmidt jedoch nicht, da er sich generell der Wertung zu enthalten pflegt und unklare Gedanken gewohnt ist, da diese bei ihm die Regel und Gewohnheiten üblicherweise schwer abzulegen sind, wenn man wie Schmidt bereits eine Weile mit ihnen lebt.
II. Schmidt existiert angemessen
Schmidt und die distinkten Momente
Schmidt nimmt die Welt nicht als gleichmäßigen Strom, sondern als Abfolge distinkter Momente wahr.
Schmidt schreibt Tagebuch
Wir sehen Schmidt an einem Schreibtisch sitzen und mit den Fingern auf die Tasten seines Laptops drücken. „Schmidt, was tust du dort?”, möchten wir fragen, was uns jedoch nicht möglich ist, da die Erzähler einer Geschichte üblicherweise nicht materiell sind und so auch nicht mit den Figuren interagieren können, obgleich natürlich auch die Figuren der Geschichte nicht materiell sind, was an der Grundstruktur von Erzählungen liegt. Statt zu fragen, schauen wir also einfach selber auf den Laptop, was zwar indiskret ist, wir uns jedoch trotzdem erlauben, da wir einerseits eine Geschichte erzählen wollen und andererseits Schmidt wohlgesonnen sind. Seine Geheimnisse sind in unserer Geschichte gut verwahrt.
Schmidt und die Angebote
Schmidt ist der Meinung, dass man die Dinge, die einem geboten werden, annehmen sollte, sofern man sie denn als Angebot erkennt.
Schmidt steuert einen Wagen
Wir sehen Schmidt, wie er in sein Auto steigt und fortfährt.
Schmidt fährt gerne Auto, manchmal sogar gut oder zumindest regelkonform, meistens aber geradeaus, was der Bauweise deutscher Autobahnen angemessen ist, da diese konzeptuell gerade, vor allem aber kreuzungsfreie Strecken sind, die aus mehrschichtigem und grundsolidem Baustoff bestehen, der nicht nur haltbar, sondern auch mit sehr hoher Geschwindigkeit befahrbar ist, was Schmidt jedoch unterlässt, da es zu gefährlich wäre, was vor allem an der Verkehrssituation, darüberhinaus an verantwortungslosen Verkehrsteilnehmern, jedoch vor allem an seiner Kontaktscheue liegt, die sich nicht nur im Sozialen, sondern auch material auf sein Auto bezogen ausprägt, welches er gerne behalten bzw. weiter fahren bzw. weiter in einem Stück oder zumindest annähernd vollständig halten möchte, auch wenn dies nur ein vorgeschobener Grund ist, wovon nur Schmidt und seine Kenner, etwa wir, wissen, da der eigentliche Grund für Schmidts Konformität mit seinem Alkoholpegel zusammenfällt, der aktuell beträchtlich ist und das alkoholisierte Fahren nicht nur gefährlich für das eigene Leben, sondern auch im weiteren Sinne für das Wohlbefinden ist, da abseits des Fahrzeugs auch die Fahrerlaubnisbescheinigung beträchtlichen Schaden nehmen kann, zumindest, sofern man nicht aufpasst, was Schmidt jedoch tut, da er sich selbst gut kennt und wir ihn natürlich auch. Schmidt scheint in eine bestimmte Richtung zu fahren.
Zumindest biegt er nirgends ab und bei kreuzungsfreien Straßen müsste man dies willentlich tun, daher scheint es nur plausibel, auch wenn viele Phänomene der Welt an Plausibilität eher mangeln.
Schmidt steuert seinen Wagen in ein fremdes Land.
Schmidt und die Metapher
Schmidts Leben ist eine Metapher, was aber niemand bemerkt.
III. Schmidt erfährt von seinem Ende
1. Schmidt entdeckt seinen Beobachter
Wir sehen Schmidt, wie er an seinem Küchentisch sitzt und methodisch die Post des vergangenen Monats sortiert, wobei er Rechnungen nach ihrer Dringlichkeit ordnet, was bedeutet, dass er sie nach dem Datum des Poststempels arrangiert, da Dringlichkeit üblicherweise mit zeitlicher Abfolge zusammenhängt, auch wenn diese Logik nicht immer zutrifft, was Schmidt jedoch ignoriert, da Ausnahmen häufig die Ordnung verkomplizieren.
Während Schmidt eine Mahnung der Stadtwerke betrachtet, die er bereits zweimal gelesen hat, ohne eine Entscheidung bezüglich ihrer Behandlung zu treffen, bemerkt er durch das Fenster, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Wagen parkt, aus dem seit drei Stunden niemand ausgestiegen ist, obwohl das Fahrzeug gelegentlich leicht vibriert, als würde darin jemand tippen oder sich bewegen.
Schmidt beobachtet das Auto mit jener geduldigen Aufmerksamkeit, die er allen rätselhaften Phänomenen widmet, und bemerkt, dass eine Person im Fahrzeug offenbar schreibt, da das schwache Licht eines Laptopbildschirms durch die Windschutzscheibe schimmert, was Schmidt als ungewöhnlich empfindet, da Menschen üblicherweise nicht stundenlang schreibend in parkenden Autos sitzen, außer sie haben einen besonderen Grund dafür.
Nach einer weiteren Stunde des Wartens verlässt Schmidt seine Wohnung und bewegt sich auf den Wagen zu, wobei er sich dem Fahrzeug von schräg hinten nähert, um den Fahrer nicht zu erschrecken, da plötzliche Annäherungen viel mit Bedrohungsgefühlen zu tun haben.
Der Mann im Auto ist etwa in Schmidts Alter und trägt eine Wollmütze, obwohl es Sommer ist, was Schmidt als erste Anomalie registriert, gefolgt von der zweiten Anomalie, dass auf dem Armaturenbrett ein aufgeschlagenes Telefonbuch des Jahres 1987 liegt, neben dem sich herausgerissene Seiten scheinbar ohne System angeordnet befinden, wobei Schmidt vermutet, dass diese Anordnung einem System folgt, das er nicht durchschaut, was ihn interessiert, aber nicht beunruhigt, da er gewohnt ist, Systemen zu begegnen, die sich seinem Verständnis entziehen.
Schmidt klopft vorsichtig an das Seitenfenster. Der Mann schreckt zusammen, dreht sich um und starrt Schmidt mit einer Mischung aus Überraschung und Erkennung an, als hätte er Schmidt erwartet, aber nicht in dieser Form.
Diese Reaktion kategorisiert Schmidt als ungewöhnlich, da die meisten Menschen entweder überrascht oder erkennend reagieren, aber nicht beides gleichzeitig, es sei denn, sie befinden sich in einem Zustand der kognitiven Dissonanz, was psychologisch möglich, aber praktisch selten ist, weshalb Schmidt beschließt, die Situation durch direkte Kommunikation zu klären.
“Entschuldigung”, sagt Schmidt, “aber Sie sitzen hier schon sehr lange.” Der Mann kurbelt das Fenster herunter und antwortet mit einer Stimme, die Schmidt seltsam vertraut vorkommt: “Ich beobachte Sie.” Diese Offenheit überrascht Schmidt, da Menschen üblicherweise nicht zugeben, dass sie andere beobachten, es sei denn, sie haben einen professionellen Grund dafür, was jedoch angesichts der improvisierten Arbeitsplatzausstattung im Auto unwahrscheinlich scheint.
“Warum?”, fragt Schmidt. “Weil Sie interessant sind”, sagt der Mann und zeigt auf seinen Laptop, auf dessen Bildschirm Schmidt einen Text erkennt, der mit den Worten beginnt: “Wir sehen Schmidt, wie er an seinem Küchentisch sitzt…” Schmidt liest weiter und bemerkt, dass der Text sein eigenes Verhalten der letzten Stunden beschreibt, das Sitzen am Küchentisch, das Beobachten des Autos, sogar sein Nähern an das Fahrzeug, alles formuliert in einem Stil, der ihm genauso bekannt wie unbekannt vorkommt, was ihn jedoch nicht weiter beschäftigt, da es für ihn keinen Unterschied macht, ob er tatsächlich etwas vergessen hat oder solches bloß glaubt.
“Sie schreiben über mich?”, fragt Schmidt. “Ich schreibe Sie”, antwortet der Mann. “Oder versuche es zumindest. Manchmal machen Sie Dinge, die ich nicht vorhergesehen habe.” Schmidt überdenkt diese Aussage und stellt fest, dass sie entweder eine logische Unmöglichkeit oder eine sehr präzise Beschreibung seiner Existenz darstellt, was ihn jedoch nicht beunruhigt, da er mit Widersprüchen zu leben gelernt hat. “Kann ich mich zu Ihnen setzen?”, fragt Schmidt. “Ich würde gerne lesen, was Sie über mich geschrieben haben.”
2. Schmidt erfährt von seinem Ende
Schmidt setzt sich auf den Beifahrersitz und nimmt instinktiv jene Position ein, die ihm das Telefonbuch von 1987, den Laptop und die vielen leeren Kaffeebecher gleichzeitig in den Blick bringt, ohne dass er den Kopf drehen muss, eine Haltung, die sowohl Aufmerksamkeit für die Arbeitsutensilien als auch Bereitschaft zum Gespräch ausdrückt, wobei er die vielen Kaffeebecher als Hinweis auf längere Arbeitsperioden interpretiert, da Becher-Ansammlungen üblicherweise zeitaufwändige Tätigkeiten dokumentieren.
“Wie lange machen Sie das schon?”, fragt Schmidt. “Das Schreiben? Ach, schon Jahre. Das Beobachten von Ihnen? Seit heute Morgen”, antwortet der Mann und nimmt einen Schluck aus einem scheinbar leeren Kaffeebecher, wobei Schmidt registriert, dass die Bewegung nicht zweckgerichtet, sondern vielmehr routiniert wirkt, als hätte sie sich bereits abseits ihres Nutzens zu einer Gewohnheit entwickelt.
“Und ich bin Ihnen bisher nicht aufgefallen?” “Doch, schon. Aber nicht so… konkret. Sie waren eher eine Idee. Jetzt sind Sie hier und sprechen mit mir, was ich nicht vorgesehen hatte, obwohl es logisch ist, da Menschen auf längere Beobachtung üblicherweise reagieren, sofern sie diese bemerken.” Schmidt nickt und liest über die Schulter des Mannes hinweg weitere Textpassagen, in denen sein eigenes Verhalten beschrieben wird, jedoch nicht nur das vergangene, sondern auch mögliche zukünftige Handlungen, als hätte der Beobachter bereits durchgespielt, was Schmidt als nächstes tun könnte.
“Sie schreiben auch, was ich noch nicht getan habe?” “Manchmal. Meistens stimmt es dann auch.” Der Mann scrollt durch mehrere Seiten Text. “Hier steht zum Beispiel, dass Sie mich fragen werden, woher ich Sie kenne.” “Woher kennen Sie mich?”, fragt Schmidt prompt, wobei er sich gleichzeitig darüber wundert, dass er eine Frage stellt, die bereits vorhergesagt wurde, was ihn jedoch nicht davon abhält, auf die Antwort zu warten.
“Das ist kompliziert zu erklären”, sagt der Beobachter. “Aber ich kann Ihnen etwas anderes sagen, was wichtiger ist.” Schmidt wartet, da Warten viel mit der Bereitschaft zum Zuhören zu tun hat.
“Sie werden sterben”, sagt der Beobachter und führt abermals die in seinem leeren Kaffeebecher enthaltene Luft zu seinen Lippen. Schmidt betrachtet diese Information mit jener analytischen Distanz, die er allen unerwarteten Mitteilungen entgegenbringt, und stellt fest, dass die Nachricht in ihm weder Panik noch besondere Trauer auslöst, sondern vor allem Neugier bezüglich der Details und Erleichterung bezüglich der Mahnungen.
“Wann?”, fragt Schmidt. “Das steht hier nicht genau. Aber bald.” “Und woher wissen Sie das?” “Das kann ich nicht erklären, ohne andere Dinge zu erklären, die noch komplizierter sind”, antwortet der Beobachter und zeigt auf den Bildschirm. “Aber es steht hier, am Ende der Geschichte.”
Schmidt versucht das Ende der Datei zu lesen, doch der Beobachter scrollt schnell darüber hinweg, als wäre der Text zu privat oder zu gefährlich für Schmidts eigene Augen. “Habe ich Zeit, meine Angelegenheiten zu ordnen?” “Das kommt darauf an, was Sie unter Ordnung verstehen. Ihre Wohnung ist bereits sehr ordentlich.” Schmidt nickt, da dies zutrifft, und stellt fest, dass die Gewissheit seines baldigen Ablebens ihm hauptsächlich Klarheit bezüglich der Prioritäten verschafft, da ihm nun endlich ausreichend Gründe für eine Entscheidung bezüglich der Zahlung an die Stadtwerke vorliegen.
“Kann ich noch etwas Sinnvolles tun?”, fragt Schmidt. Der Beobachter lächelt zum ersten Mal, seit Schmidt in das Auto gestiegen ist und klappt das Telefonbuch zu. “Sie tun bereits etwas sehr Sinnvolles. Sie vervollständigen die Geschichte, indem Sie sich an ihrer Entstehung beteiligen. Sie sorgen dafür, dass der Text stimmt.”
3. Schmidt schreibt mit
Schmidt betrachtet den Beobachter, der auf seinen Laptop-Bildschirm starrt, als würde dort in diesem Moment neuer Text erscheinen, was Schmidt zu der Frage veranlasst, ob der Text tatsächlich entsteht, während sie sprechen, oder ob alles bereits geschrieben wurde, eine Überlegung, die philosophische Implikationen hat, denen Schmidt normalerweise ausweicht, die ihm aber in dieser Situation praktisch relevant erscheinen.
“Kann ich lesen, was über mich geschrieben steht?”, fragt Schmidt und deutet auf den Bildschirm. “Das ist problematisch”, antwortet der Beobachter, “da der Text sich verändert, während Sie ihn lesen. Es ist, als würden Sie versuchen, Ihr eigenes Verhalten vorherzusagen, während Sie es ausführen.”
Schmidt versteht diese Erklärung nicht vollständig, nickt aber trotzdem, da Verstehen häufig weniger wichtig ist als die Bereitschaft zur Kooperation, und außerdem weiß Schmidt aus Erfahrung, dass ungewöhnliche Situationen oft ungewöhnliche Logiken erfordern, denen man sich am besten durch praktisches Ausprobieren nähert, was Schmidt auch hier für ein passendes Vorgehen hält.
„Vielleicht könnte ich Ihnen beim Schreiben helfen”, schlägt Schmidt vor, “da ich ja derjenige bin, über den geschrieben wird, und es möglicherweise Dinge über mich gibt, die Sie nicht wissen können, weil Sie mich nur von außen beobachten.”
Der Beobachter dreht sich zu Schmidt um und betrachtet ihn mit einem Ausdruck, der zwischen Überraschung und Erleichterung changiert, als hätte Schmidt etwas vorgeschlagen, worauf er gehofft, aber nicht zu fragen gewagt hatte.
“Was für Dinge?”, fragt der Beobachter.
“Sie schreiben zum Beispiel, dass ich ‘langsam gehe’, aber das ist ungenau beobachtet. Ich unterscheide grundsätzlich zwischen drei Arten des Gehens: dem zielgerichteten Gehen, bei dem die Geschwindigkeit der Dringlichkeit entspricht; dem meditativen Gehen, bei dem die Geschwindigkeit der Aufmerksamkeit für die Umgebung angepasst wird; und dem neutralen Gehen, das weder schnell noch langsam ist, sondern einfach der natürlichen Schrittfrequenz folgt. Was Sie als ‘langsam’ beschreiben, ist neutrales Gehen.”
Der Beobachter tippt diese Information sofort in seinen Laptop, wobei Schmidt bemerkt, dass dort, wo vorher ‘Schmidt bewegt sich langsam durch die Stadt’ stand, nun ein ganzer Absatz über die drei Kategorien des Gehens entstanden ist.
“Das ist sehr hilfreich”, sagt der Beobachter. “Gibt es noch andere Korrekturen, bei denen Sie helfen können?”
“Sie beschreiben, dass das Geräusch der Straßenbahn für mich ‘laut’ sei, jedoch empfinde ich es nicht als akustisches Phänomen, sondern als eine Art rhythmische Struktur, die ich weniger mit den Ohren als vielmehr im Bereich der Schulterblätter wahrnehme, dort, wo auch das Gefühl bevorstehender Montage sitzt.”
Der Beobachter schreibt mit einer Konzentration, die Schmidt beeindruckt, wobei er bemerkt, dass die Geschwindigkeit des Tippens gleichmäßig bleibt, unabhängig von der Komplexität der Information, was auf eine professionelle Routine hindeutet.
“Könnten wir das öfter machen?”, fragt Schmidt. “Diese Art von Zusammenarbeit?”
“Sie meinen, Sie würden gerne regelmäßig über sich selbst erzählen, damit ich präziser über Sie schreiben kann?”
“Ja, das erscheint mir respektvoller als ungenaue Beschreibungen.” Der Beobachter lächelt wieder, diesmal breiter als zuvor. “Das ist ein sehr guter Vorschlag. Besonders da Sie ja nicht mehr viel Zeit haben.” Schmidt nickt und empfindet Befriedigung darüber, bei der Lösung eines Problems beigetragen zu haben, obwohl er weiß, dass es sich um das Problem seiner eigenen literarischen Darstellung bzw. ihres Endes handelt, was ihm seltsam, aber nicht unlogisch, vor allem jedoch angemessen erscheint, da die korrekte narrative Dokumentation der eigenen Existenz vermutlich die einzige Form der Unsterblichkeit ist, die sich ohne religiösen Glauben erreichen lässt.
IV. Schmidt erledigt Grundsätzliches
Schmidt betritt Räume durch Türen
Schmidt betritt den Raum durch die Tür, wobei er Türen anderen Durchgangsmethoden vorzieht, da das Durchschreiten von Wänden viel mit bauphysikalischen Unmöglichkeiten und alternative Raumwechselmethoden viel mit Sachbeschädigung zu tun haben.
Schmidt spricht in ganzen Sätzen
Schmidt spricht in ganzen Sätzen, wobei er üblicherweise in ganzen Sätzen spricht, da verbale Artikulation viel mit syntaktischer Vollständigkeit und unvollständige Äußerungen viel mit der Erwartung ihrer Vervollständigung zu tun haben.
Schmidt interpretiert eine Knopflosigkeit
Wir sehen Schmidt, wie er am Schreibtisch sitzt und mit mittlerer aber entsprechend vorhandener Aufmerksamkeit den fehlenden Knopf seines Hemdes betrachtet, welcher nicht dort fehlt, wo die Abwesenheit einer sofortigen Behebung bedürfte, z.B. am Kragen, jedoch auch nicht am unteren Saum, wo sie bisweilen unbemerkt bleiben könnte, sondern genau in jener mittleren Region des Brustbereichs, die sowohl sichtbar als auch ignorierbar ist, ein Zwischenraum der Bedeutsamkeit, in dem wir alle gelegentlich verweilen, ohne es zu bemerken, während Schmidt es bemerkt, ohne zu verweilen.
Schmidt unterscheidet grundsätzlich zwischen vier Arten der Knopflosigkeit: die plötzliche, die durch einen einmaligen Kraftakt herbeigeführt wird; die schleichende, bei der sich der Knopf allmählich aus seinem Gewebe löst; die mysteriöse, bei der der Knopf verschwindet, ohne dass der Zeitpunkt oder die Umstände seines Abgangs nachvollziehbar wären; und schließlich jene, die man als vorbeugende Knopflosigkeit bezeichnen könnte, bei der ein bereits lockerer Knopf entfernt wird, bevor er von selbst abfallen kann, was zwar ungewöhnlich aber nicht undenkbar und dies vor allem nicht in Geschichten wie diesen ist.
Schmidt prüft den Stoff um die Stelle, an der der Knopf einst befestigt war, folgt mit dem Finger den feinen Fasern, die aus den vier kleinen Löchern herausragen, spürt, wie sie sich durch die Bewegung des Stoffs leicht kräuseln, eine Mikrolandschaft aus gebleichter Baumwolle, ein Kosmos der Abwesenheit, in dem die Erinnerung an den Knopf als negative Form fortbesteht, die Schmidt mit jenem Teil der Wahrnehmung erfasst, der für die Registrierung von Verlusten zuständig ist, während wir seiner Beobachtung beiwohnen, ohne sie teilen sondern nur äußerlich begleiten zu können, was uns in eine Position versetzt, die der seinen nicht unähnlich ist, da auch wir beobachten ohne teilzunehmen, was bei Schmidt jedoch an seinem Charakter, bei uns hingegen an unserer Position liegt, da wir eine Geschichte erzählen und diese nicht erfinden, was uns aber prinzipiell möglich wäre und wir durchaus zum Anfang der Geschichte zurückkehren und den Knopf unsererseits hinzufügen könnten, was unter unseren vielen Ideen leicht zu den besseren zählt und wir ihr vielleicht nachgehen sollten, da originellen Ideen häufig ebenso viel Potential wie Risiko zueigen ist und wir uns ohnehin schon viel zu lange in die Gemütlichkeit einer geraden Erzählung bequemt haben.
Schmidt empfindet eine Knopfanwesenheit
Wir sehen Schmidt, wie er am Schreibtisch sitzt und mit Überraschung feststellt, dass sein Hemd vollständig zugeknöpft ist, obwohl er sich deutlich im Besitz einer Erinnerung wähnt, dergemäß einer der Knöpfe fehlen müsste, was ihn als Diskrepanz nicht oder nur wenig beunruhigt, sondern mehr mit jenem distanzierten Interesse erfüllt, das Schmidt für die Unzuverlässigkeiten seiner eigenen Wahrnehmung sicherheitshalber bereithält und sich dies bewährt hat.
Schmidt unterscheidet grundsätzlich zwischen drei Arten von Erinnerungstäuschungen: jene, bei denen man sich an etwas erinnert, das nie geschehen ist; jene, bei denen man etwas Geschehenes vergisst; und jene, bei denen die Erinnerung zwar korrekt, aber zeitlich falsch verortet ist, wobei seine gegenwärtige Situation entweder der ersten oder der dritten Kategorie angehören muss, was ihn zu der Überlegung führt, ob er möglicherweise den fehlenden Knopf eines anderen Hemdes auf dieses projiziert hat.
Er betastet den Knopf, den seine Erinnerung als abwesend klassifiziert hatte, spürt die glatte Oberfläche unter den Fingerkuppen, nimmt die leichte Kühle des Materials wahr, eine taktile Realität, die im Widerspruch zu seiner mentalen Karte steht, ein Phänomen, das Schmidt nicht als Fehlfunktion seines Gedächtnisses betrachtet, sondern als Hinweis auf die grundsätzliche Unzuverlässigkeit jeder Wahrnehmung, über die beispielsweise Philosophen gerne nachdenken, der Schmidt jedoch gewohnheitsmäßig pragmatisch begegnet und scheinbar unzuverlässig vorhandene Knöpfe üblicherweise betastet, da taktile Überprüfung viel mit der Vergewisserung von Realität zu tun hat.
Schmidt knöpft sein Hemd auf und wieder zu und stellt fest, dass tatsächlich alle Knöpfe vorhanden und funktionsfähig sind, eine Tatsache, die in einer rationalen Weltordnung selbstverständlich wäre, in Schmidts Erfahrungswelt jedoch eine leichte Dissonanz erzeugt, nicht weil er an seiner Wahrnehmung zweifelt, sondern weil er sich deutlich an eine andere Konfiguration erinnert bzw. spürt, die nun neben der gegenwärtigen Realität existiert, ohne dass eine die andere auslöschen könnte, was ihn zu der Überlegung führt, ob möglicherweise beide Zustände gleichzeitig wahr sein könnten, nur in verschiedenen Versionen der Wirklichkeit, eine Möglichkeit, die Schmidt als so wahrscheinlich wie unwahrscheinlich hält und er sich schließlich weder für das eine noch das andere entscheidet, was er aber immerhin auch nicht muss und was je nach Beurteilung auch nichts prinzipiell schlechtes ist.
Schmidt beantwortet Fragen mit Antworten
Schmidt beantwortet Fragen mit Antworten, wobei er üblicherweise Fragen mit Antworten beantwortet, da kommunikative Wechselseitigkeit viel mit informativer Reziprozität zu tun hat.
V. Schmidt stirbt in Städten
Wenn Schmidt in Städten stirbt, mag das für ihn verständlich und sogar unproblematisch sein, so wie viele Phänomene, die Schmidts Alltag begleiten, für ihn verständlich und sogar unproblematisch sein mögen, da Schmidt mit ihnen bereits vertraut ist und sich an sie gewöhnt hat, was insofern auch nicht weiter wundern muss, da es sich dabei um Phänomene aus Schmidts Alltag handelt, die entsprechend wiederkehrend oder zumindest für ihn wiederkehrend sind, und diese womöglich keine Phänomene unseres Alltags sind, vor allem, wenn unser Alltag von dem Schmidts abweicht und somit Schmidts Üblichkeit unserer Unüblichkeit entspricht und für uns daher Fragen aufwirft, was verständlich ist, vor allem, wenn es sich bei jenem Unüblichen um das Sterben in Städten handelt.
Nicht unbedingt unüblich ist Schmidts Sterben, wenn wir uns Schmidts ontologischen Status vergegenwärtigen und ihn als fiktive Figur einer Erzählung ernst nehmen, die von bestimmten Zwängen des Faktischen ausgenommen ist, wobei das Gegenteil zwar eine reizvolle narrative Möglichkeit wäre, die im vorliegenden Falle jedoch nicht bedeutsam ist, da Schmidt nicht tatsächlich in Städten stirbt, sondern diese Formulierung von ihm rhetorisch in Bezug auf seine sozialen Schwierigkeiten verwendet wird, die uns unpassend überspitzt, Schmidt jedoch möglicherweise angemessen erscheint, was jedoch leider nicht letztgültig auszumachen ist, da Schmidts Innenleben uns verborgen ist und wir nicht wissen, wie Schmidt sich fühlt, was sich für uns als Erzähler jedoch leicht ändern ließe, sofern wir uns für eine Änderung des narrativen Rahmens entscheiden.
Dass Schmidt alleine lebt, ist uns ebenso bekannt, wie dass Schmidt bereits lange und auch gerne alleine lebt, obgleich es weder für Schmidt noch uns transparent ist, ob Schmidt tatsächlich gerne alleine lebt oder er sich nur so sehr an dieses ge- und vom Anderen entwöhnt hat, dass ihm die gängigen Praxen des Sozialen nicht mehr bekannt oder zumindest nicht mehr so unmittelbar bekannt sind, wie es in geregelten sozialen Räumen üblicherweise nötig ist, da geregelte soziale Räume regelkonformes Verhalten verlangen und persönliche Begegnungen in sozialen Räumen erst durch beides, durch regelkonformes sowie individuell-spontanes Verhalten, entstehen, wobei letzteres erst durch Kenntnis, Übung und Verinnerlichung des anerkannt konformen Verhaltens möglich wird, so wie freies Spiel erst auf Beherrschen der Regeln folgt.
Schmidt hielt sich bereits in verschiedenen sozialen Räumen auf und konnte dabei ein Grundverständnis allgemein angemessenen Verhaltens entwickeln, das ihm im Leben bereits viele Türen geöffnet hatte. So beherrschte Schmidt tadellos einige Begrüßungs- oder Abschiedsformeln und war grundsätzlich mit dem Konzept des Fragenstellens vertraut. Wir wissen etwa von einer Begebenheit, in der Schmidt alle drei Sprachmuster zugleich bzw. nacheinander anwendete und dies sogar situativ angemessen. Schmidt erinnert sich gern dieser Begebenheit, die ihn zurecht mit einem gewissen Stolz ausfüllt, was ebenfalls angemessen ist, da sein Gegenüber ihm das Gespräch explizit dankte.
Es sind nicht nur seltene Gelegenheiten, sondern überhaupt nur für diejenigen Gelegenheiten, denen die entsprechenden Heiten gelegen kommen, was bei Schmidt nur selten der Fall ist, da Schmidt solcherlei nur mit jener Vorsicht begegnet, in der er sich für solche Fälle besonders geübt hat und die er von jener Vorsicht unterscheidet, die für andere Fälle vorgesehen und bislang weniger ausgebildet ist, da jene anderen Fälle Schmidt üblicherweise seltener begegnen als ihr Gegenteil und die vorliegende oder vielmehr noch nicht vorliegende Gelegenheit zur ersten Gruppe gehören würde, wenn sie denn erschiene, was sie jedoch nicht tut und wir es daher in dieser Sache belassen müssen.
Schmidt beherrscht die für eine nur in Erzählungen existierende Figur ungewöhnliche Fähigkeit, die von seinem Erzähler geplante Narration zu unterbrechen und in andere Richtungen zu lenken. Es wäre nicht abwegig, einer Geschichte über Schwierigkeiten mit dem sozialen Leben in Städten, etwas Tempo durch das plötzliche Auftreten einer sozialen Situation zu verleihen, was auch durchaus geplant war und eine wichtige Bedingung nicht nur für Spannungs- und Erzählverlauf bedeutete, sondern auch wesentliche Bedingung des nicht nur dramatischen, sondern auch erschreckenden, vielleicht etwas zu pädagogischen, in jedem Falle jedoch liebevollen und versöhnlichen Endes darstellte.
Dass Schmidt uns um dieses brachte, könnten wir ihm verständlich übelnehmen.
Was wir aber nicht tun, da wir Schmidt wohlgesonnen sind.
VI. Schmidt und die Bierverschlüsse
Meine Damen, meine Herrn
ich grüße Sie und das auch gern.
Sie wiederum begrüßen bitte,
Schmidt (senior) hier in unserer Mitte.
Sie kennen Schmidt? Erzähl’n Sie gern:
Was wissen Sie von diesem Herrn?
Er sitzt und steht und andersrum?
Er isst und trinkt und weiß warum?
Sie haben ihn im Park geseh’n?
Zum Landratsamt hinübergeh’n?
Schmidt atmet, haben Sie gehört?
Nun gut. Doch wer weiß was Schmidt stört?
Schmidt stört selten, wie wir wissen,
doch stört sich Schmidt an Bierverschlüssen.
Sie kennen einen? Welchen denn?
Ja gut, okay, den Kronkorken.
Wie bitte? Der Drehverschluss?
Aus Frankreich? Wenn’s denn seien muss.
Der Bügel? Gut! Sie wissen ja,
der Plopp ist friesisch Gloria.
Wie sagen Sie? In Belgien?
Verschließt man Bier auch mit Korken?
Aus Kork! Tatsächlich? So. Ach was.
Wir wussten dies. War nur ein Spaß.
Sie kennen einen Vollverschluss?
Für Bier, das man nicht trinken muss?
Die Aufreißlasche, danke Ihnen!
Noch sonst etwas übriggeblieben?
Nichts mehr sonst?
dann Dankeschön.
Schmidt bleibt hier,
Sie dürfen geh’n.