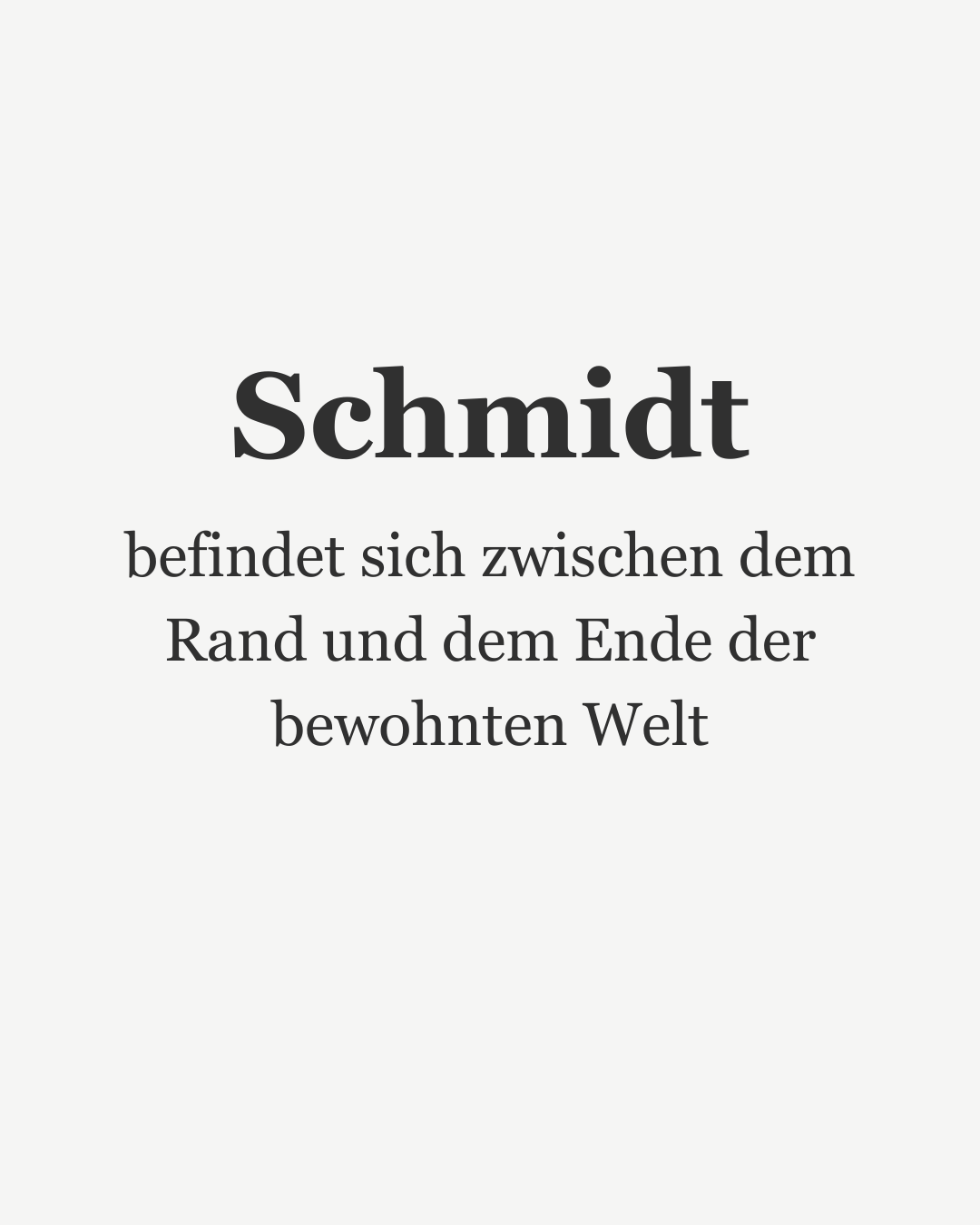Ob ich hier willkommen bin, kann ich nicht genau sagen. Ich bin es wohl genauso wie ich es nicht bin. Ich werde hier so sehr gemocht wie ich auch nicht gemocht werde. Ein bewegliches Faktum ohne große Bedeutung, etwas, das von der Straße springt, wenn man sich mit dem Auto ausreichend selbstbewusst nähert. Etwas, das vorhanden und gleichzeitig an diesem Ort völlig unbedeutend ist — so wie auch das große Weltgeschehen und der sonstigen Dinge Lauf.
Palermo erscheint mir wie eine Zeitkapsel gleich mehrerer Epochen. Es wirkt wie ein Italien, das vor 30-40 Jahren existierte. Bzw. richtiger: Wie ein zu dieser Zeit existierendes Bild von Italien. Darüberhinaus jedoch erscheint mir Palermo als vor allem eines: einzigartig. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich kenne es von nirgendwo sonst.

Vielleicht hat es mit der besonderen Struktur der Zeit zu tun, in der hier gelebt wird. Die sizilianische Sprache kennt keine Futur-Form. Das ist erstmal ein Fakt und mit der kulturellen Interpretation solcher Dinge sollte man vorsichtig sein. Und doch scheint sich etwas davon in der Architektur oder zumindest ihres Zustandes widerzuspiegeln. Vor Jahrhunderten lebten Adel und Klerus hier weit über ihre Verhältnisse und bauten mächtig und mächtig prunkvoll. Eine Fremdherrschaft löste die vorangegangen ab und jeder wollte prächtiger bauen als die letzte. Der Wirtschaftsleistung der Insel entsprach dies zu keiner Zeit, vor allem nicht heute. Und so bröckelt die Grandezza ungehindert zu Boden, wo sie mit dem vielen Müll an eine Straßenecke zusammengeschoben und schließlich liegengelassen wird, bis ihn jemand abholt oder auch nicht. Ist es die Widersprüchlichkeit zwischen den bröckelnden Fassaden und der allgegenwärtigen opulenten Architektur, die mir so einmalig erscheint? Diese schutzlose Gegenwart ohne grammatikalischen Zufluchtsort im Morgen, ein endloses Jetzt, das weder Abriss noch Restaurierung kennt?
Unbekannte Zeitstrukturen, sie sind nicht nur auf der Oberfläche, sondern auch Untertage zu erfühlen: In den Katakomben der Kapuzinermönche sind die präparierten Skelette der Fratelli und des Adels ausgestellt. Am Rücken werden die Skelette aufgehängt und baumeln an einer Wäscheleine über die Jahrhunderte hinweg in die Ewigkeit hinein. Grotesk und absurd starren die unvollständigen Schädel vor sich hin, von Motten zerfressen sind die fürs Jenseits bestimmten Kleider und geben das Stroh frei, mit dem die Gerippe ausgestopft wurden. Diese Ausstellung, die jene Brüder des 16. Jahrhunderts explizit als Auseinandersetzung mit dem Leben und einem positiven „memento mori“ intendiert hatten, stößt bei mir fast das Gegenteil an: Man lebt so sein Leben und hält es für das wichtigste und bedeutendste und am Ende sieht man eben so aus: zerfleddert, zerfallen, anonym, grotesk.

Palermo, so scheint es mir, ist kein Scherz. Sicher, hier findet an jeder Ecke das lockere bunte Leben statt, das unser Bild vom Mittelmeerraum so sehr prägt. Doch scheint mir dies nur vordergründig. Ich glaube, das hinter dem entspannten Leben ein tiefer Ernst steckt und dass die Menschen hier eigentlich alle ein großes, abstraktes, mediterranes Regelwerk vor Augen haben. Ein hintergründig gewusstes und nirgends formuliertes Gesetz des Mittelmeeres. Die Palermitaner kümmern sich um sich selbst und um ihre Gesellschaft. Und diese Gesellschaft scheint nicht Italien zu heißen.
Dieses eigene Gesetz, nach dem die Stadt tickt, scheint irgendwie fragil und nur von vagem Kitt zusammengehalten, ist aber seit Jahrhunderten nicht zerbrochen. Während andernorts die Gesetze der Moderne die Dinge ordnen und klinisch uniformieren, konserviert der Staub hier eine Idee von einem Leben, das ich so nicht kenne. Ist es diese fremde Sozialität, die mir so unvergleichlich erscheint? Überall lebendig, überall trubelig, irgendwie überall kriminell, ohne dabei aber finster zu sein. Eine latente Kriminalität, die man wahrnimmt, die sich aber nicht gegen einen selbst richtet.
Kann gut sein, dass meine Begeisterung über die viele Fremdheit vor allem daher rührt, dass Palermo mein erster Kontakt mit Süditalien ist, das ich sonst nicht kenne. Aber das Schöne am Staunen ist ja: Staunen fragt nicht wieso. Staunen ist einfach da, Staunen nimmt ein. Und ist nicht auch genau das ein Privileg der Unkenntnis? Und des Nichtwissens? Das besondere Glück, dass es da so endlos viel Fremdes in- und womöglich außerhalb der Welt gibt? Wenn man sich offen und mit möglichster Freiheit von Vor- aber auch sonstigen Urteilen in die Welt wirft, kann jeder Eindruck auf Resonanz treffen, wo immer er auch herstamme.
Mir macht das viel Spaß.