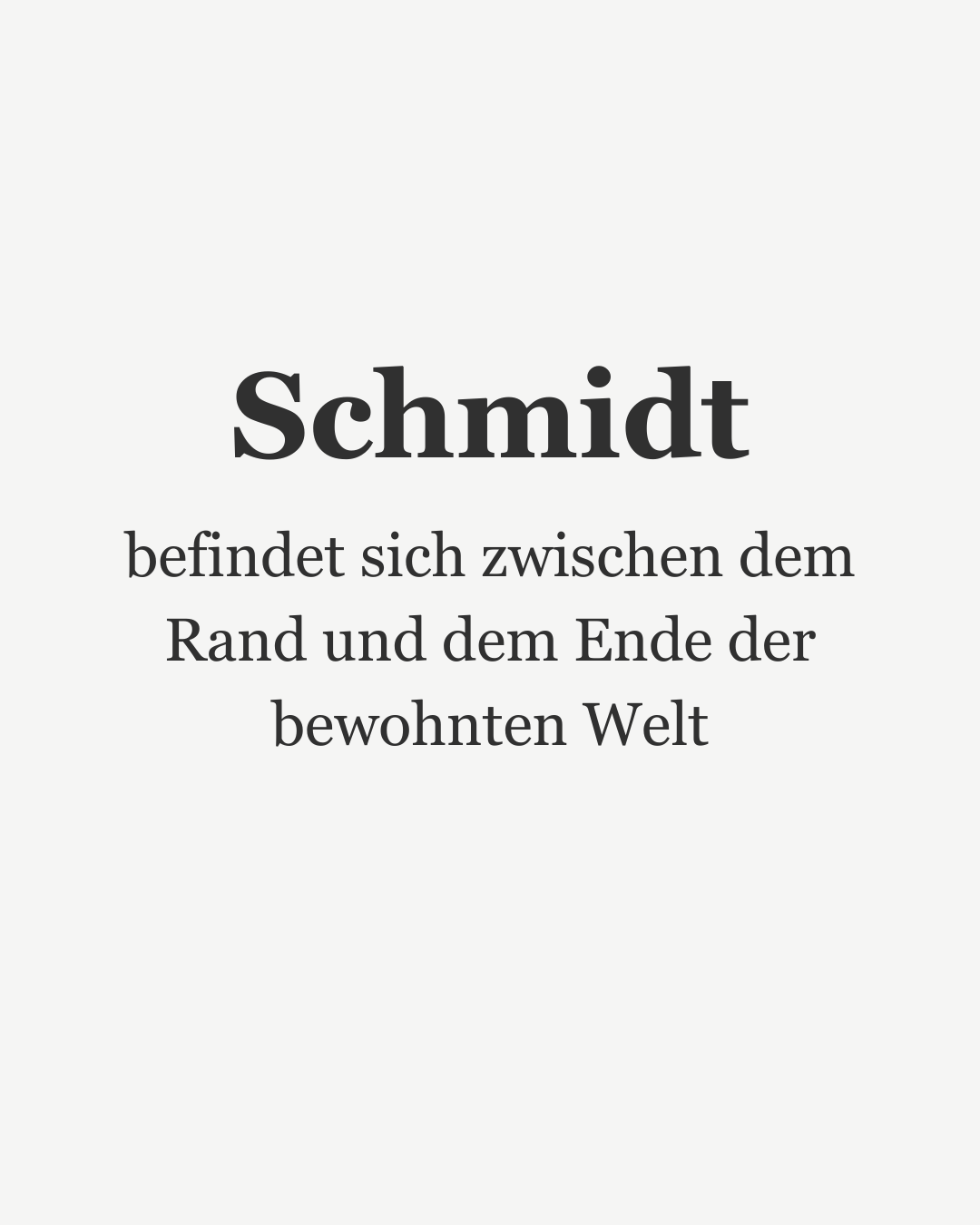Westsizilien gehört zu den ärmsten Regionen Europas. Sizilien hat zusammen mit Kalabrien das niedrigste BIP Italiens, die Arbeitslosigkeit liegt bei 22%, bei jungen Menschen sogar bei 39%. Das war auch historisch so — und wird sich voraussichtlich nicht ändern. 1968 ließen hier tektonische Verwerfungen die Erde beben und zerstörten ganze Dörfer. 400 Menschen starben, 100.000 wurden obdachlos.
Die Situation vor dem Beben: schlecht. Nach dem Beben: katastrophal — und das nachhaltig. Über Jahre hinweg lebten die ehemaligen Bewohner:innen in „Baraccopoli“: Wellblechhütten und Zelten ohne Isolation, Barackendörfer ohne Perspektive. Denn obgleich unmittelbar der Wiederaufbau der Ortschaften geplant wurde, verzögerte sich dieser durch Korruption (wie erinnern uns: Cosa Nostra) und Bürokratie über Jahre. Manche lebten 15 Jahre unter Wellblech, bis sie in moderne Zweckbauten aus Beton umgesiedelt wurden. Das Ergebnis war eine Ab- und Auswanderungswelle nach Norditalien und eine entwurzelte Bevölkerung in Planstädten jenes modernen Stils, der anderswo großflächig abgerissen und umstrukturiert wird.
Ein Produkt dieses Prozesses ist „Nouva-Gibellina“ — 4200 statt ursprünglich 6000 Einwohnenden.
Der linke Bürgermeister Ludovico Corrao unterstützte sehr rasch nach der Katastrophe einen vogelwilden Plan: Unter Mitwirkung von zahlreichen Künstlern moderner Strömungen sollte Gibellina als utopisches Projekt und Planstadt neu errichtet werden. Angelehnt an die Gartenstadt-Idee der Bauhaus Bewegung, wurde das neue Gibellina außerhalb der Erdbebenzone geplant und sogar errichtet. Heute beherbergt Nuova-Gibellina die größte Dichte moderner Kunstwerke ganz Italiens.
Recherchiert man zu Nuova-Gibellina, so stößt man auf Unmengen von Kritik: heruntergekommene Betonwüste, weder funktional noch für Menschen gebaut. Mahnmal irrer Fantasien durchgeknallter sozialistischer Künstler ohne Sinn für die kulturellen Eigenheiten westsizilianischer Gesellschaften. Und ja, der letzte Punkt stimmt. Die restlichen Einwände: unfassbarer Blödsinn. Was ist hier also los?
Nuova-Gibellina fühlt sich an wie eine deutsche Kleinstadt oder ein übers Reißbrett aus dem Boden gestampfter Speckgürtel einer deutschen Großstadt. Breite Straßen, autofreundliche Straßenplanung, wenig Anreiz zum Spazieren, zu große Distanzen für spontane Begegnungen. Dazwischen Palmen.
In den 20er und 30er Jahren entwickelte die Bauhaus-Schule um Walter Gropius nicht nur neue Formen von Architektur und Stadtplanung, sondern eine ganzheitliche Idee von Design der kreatürlichen Umwelt des Menschen. Architektur sollte keinem Selbstzweck folgen, sondern sich von der Notwendigkeit der Bedürfnisse ableiten und möglichst funktional auf diese reagieren bzw. ihnen entgegenkommen. All das jedoch nicht nur für eine wohlhabender Bürgerschaft, sondern möglichst günstig, leicht reproduzierbar und flächendeckend einsatzbar. Wohnen wurde ganzheitlich gedacht. Ein Ergebnis dieser interdisziplinären Zusammenarbeit war eine Weiterentwicklung der Idee der Gartenstadt: Kleine, aneinandergereihte Einfamilienhäuser mit Gärten, in Zeilen gegengleich angeordnet, sodass zwischen den Zeilen eine Straße mit Parkplätzen für die aufkommende und sich breitenwirksam etablierende Individualmobilität entstehen konnte. Links und Rechts jeweils Hauseingänge, dahinter zueinandergerichtet kleine Gärten. Bezahlbare Architektur, ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Menschen der 70er Jahre.
Die ursprüngliche auf den Menschen ausgerichtete Bauhaus-Idee wurde im Laufe der 70er und 80er Jahre jedoch auf bloß eines ihrer Merkmale runtergedampft: Günstige, schnell errichtbare und leicht reproduzierbare Massenunterkünfte. Unsere heutigen Beton- und Hochhaussiedlungen. Mit einem von menschlichen Bedürfnissen her gedachten Design hat dies nichts mehr gemein.
Die Planer von Nuova-Gibellina knüpften lose an diese mitteleuropäische Idee an und strebten nach einer künstlerisch aufgewerteten Idealstadt für ca. 10.000 Einwohner:innen. Und wer sich geistig etwas beweglich zeigt, sieht sofort: Dieser Plan ist hervorragend gelungen. Geht man mit dem eigenen mitteleuropäischen, von hohen Mieten und wenig Platz geprägten Blick durch den Ort, wird man fast sehnsüchtig: Solch eine Siedlung wäre in unseren Großstädten das begehrteste Quartier einer Schicht junger, wohlhabender Familien. Platz en masse, grün, autofreundlich. In Frankfurt heißt so ein Quartier „Römerstadt“, in Freiburg „Vauban“.
Versetzt man sich allerdings in die Situation eines Menschen aus Westsizilien, der eine vollkommen andere Sozialisation und entsprechend andere Vorstellungen von gelungenem Sozialraum hat, wirkt Nuova-Gibellina wie das gelandete Raumschiff von Außerirdischen: kulturell völlig deplatziert.
Da stecken wir nun also: im Widerspruch. Eine mit sehr viel Herz, Geist und Wohlwollen geschaffene Stadt, funktional, schön, freundlich — aber im falschen kulturellen Raum. Es hat viele Gründe, wieso mediterrane Orte ihre Form erhielten: Dunkle, enge Gassen kühlen den öffentlichen Raum auf ein erträgliches Maß, so dass Sozialität außerhalb des Familienumfeldes überhaupt möglich wird. Das trubelig-gesellige Miteinander wurzelt in dieser Enge und ist gleichzeitig auf sie angewiesen. Die deutsche Individualfamilie sucht geschlossenen Raum, dessen (so zumindest die hier implizite These) die mediterrane Gesellschaft nicht unbedingt bedarf; bzw. die damit einhergehenden Praxen des Sozialen hier unüblich sind. Und nun wurden sie also hierher gesiedelt, die ehemaligen Bewohner:innen des alten Gibellina. In eine Stadtstruktur, die ihre gewohnten sozialen Zusammenhang nicht ermöglicht. Menschen, mit Geschichte und Habitus, geworfen in ein Umfeld, in dem sie sich nicht unmittelbar verhalten können.
Ich habe in Nuova-Gibellina an vielen Ecken den utopischen Geist jener Schöpfer spüren können und je ausführlicher ich mich auf diesen einließ, desto großartiger erschien mir das gebaute Resultat. Dass mir das so leicht fällt, liegt aber selbstverständlich an der privileglierten Position des Touristen, der es sich erlauben kann, ein Kunstwerk nachzuvollziehen, ohne mit ihm in Interaktion treten, geschweige denn in ihm leben zu müssen. Ich darf mich einlassen, auf den ganzen materialisierten Geist in jedem Gebäude, jeder Installation, jeder Idee, die hinter einer Straßenzeile steckt. Das ganze anregende Hirngebrizzel, das von all der Plan-Kultur in mir ausgelöst wird.
Aber: Ich darf auch wieder gehen. Andere müssen hier bleiben.
Das alte Gibellina ist heute übrigens ein dramatisches, aber auch kurioses Kunstwerk: Ab 1981 begann Alberto Burri über dem ehemaligen Dorf ein riesiges Betonkunstwerk zu schaffen. Auf einer Fläche von 300x400m errichtete er anhand des alten Straßenplans eine 1,60m hohe Betondecke, die lediglich dort abgesenkt ist, wo früher Straßen verliefen. So streift man heute auf den alten Wegen zwischen Betonwänden durch den Plan des alten Gibellina. Frei in der Landschaft, mitten im Nirgendwo, weit ab von jeder Ortschaft liegt es da: eines der größten Denkmäler Europas.
Gibellina, neu und alt. Ein vollkommen irrer Mindfuck im besten Sinne, mitten im Nirgendwo, in der grünen Leere des westsizilianischen Hügellandes.