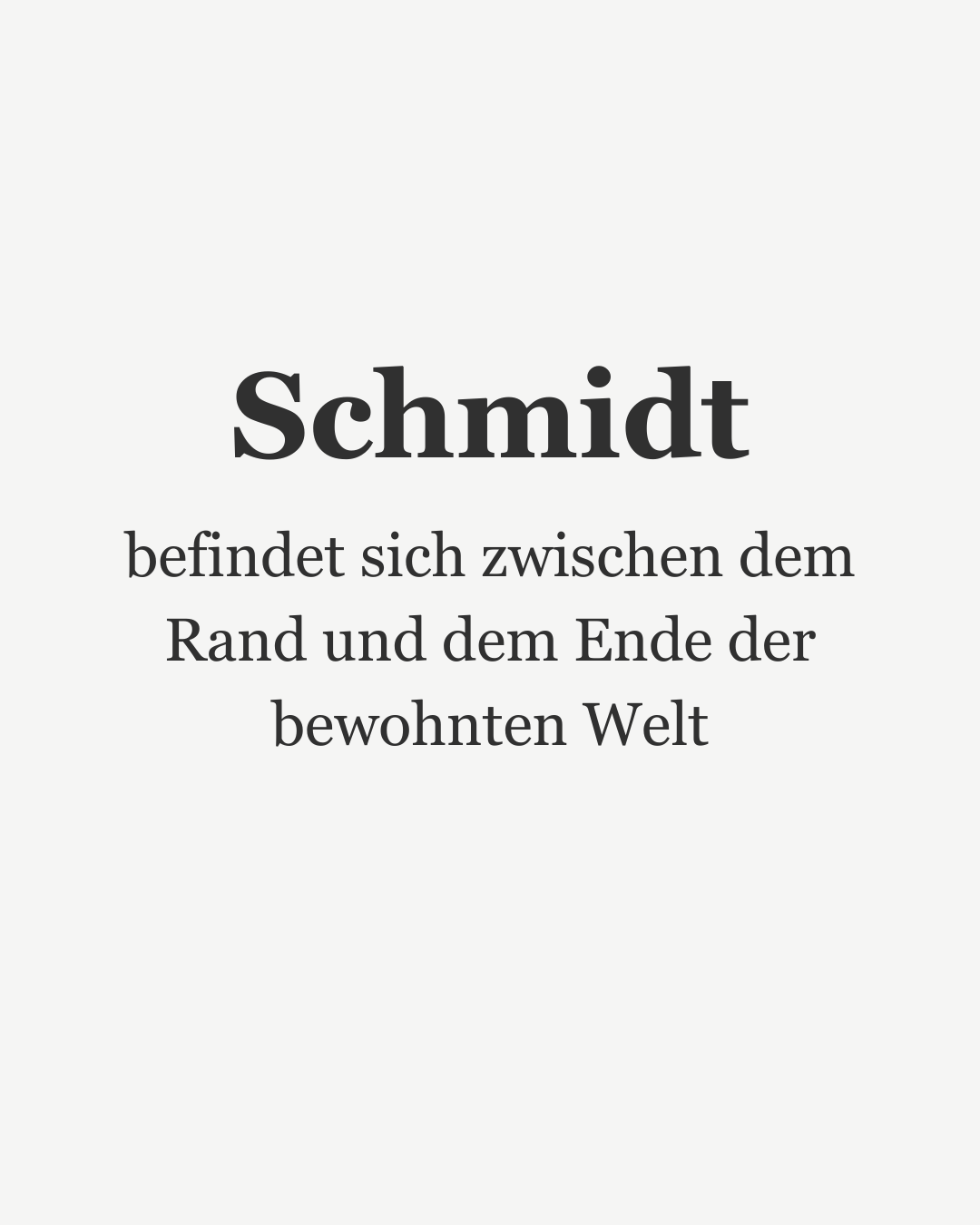„Es fühlt sich merkwürdig an, wenn das gewohnte Leben sich ändert“, hat Schmidt letztens zu mir gesagt. Und zweifellos hat er damit auch recht. Und sicher macht es die Sache verständlicher und also auch ein wenig besser – jedoch aber halt auch nur ein wenig. Vor genau einem Jahr verweigerten Schien- und Wadenbein vorübergehend ihren Dienst bei mir und beendeten damit nicht nur ein eigentlich intaktes Miteinander und einen wilden Klettersommer, sondern wohl auch – so sollte sich später andeuten – eine ganze Lebensphase. Auf Jahre, die teils zu ihrer Hälfte am Fels spielten, folgte die einjährige Einstellung am Schreibtisch auf vier Rädern, zwar hie und da von kleineren Abenteuern unterbrochen, aber doch zweifellos nicht bloß etwas anderes, sondern eher etwas ganz anderes.
Und weder ist der Phasenwechsel noch die neue Phase etwas Schlechtes – im Gegenteil -; doch werden solche Zeiten immer von etwas begleitet, das meine Freundin Kira als „Anpassungsschmerz“ bezeichnet: Nicht die veränderte Situation selbst schmerzt. Aber die Umstellung tut es. Wie lange das gehen mag, bestimmen viele, vor allem aber unbekannte und daher eigentlich sowieso egale Faktoren. Und vielleicht waren es auch die gleichen vielen, vor allem aber unbekannten und daher eigentlich sowieso egalen Faktoren, die dafür sorgten, dass ich über den Winter und das Frühjahr nicht mehr richtig zum Klettern zurückgefunden habe.
Das Leben liebt ja Paradoxien. Über diese kann es uns so toll zeigen, dass unser ganzes Hirn- und Vernunftbedürfnis nach Verständnis und Klarheit nur ins Leere laufen kann, weil solches eben nicht zu haben ist. Denn paradox erscheint diese seltsame Dankbarkeit gegenüber der ganzen verwirrenden Veränderung: Zwar hat sie einigen Begeisterungen temporär den Stecker gezogen und diese in den Keller gestellt. Sie hat aber neues Leben in eine ältere Leidenschaft gehaucht, die sich ob der vielen rastlosen Aktivität scheu zurückgezogen hatte: nämlich dieser grenzenlosen Begeisterung für dieses irre Ding der SPRACHE.
Seit sie wieder ausreichend Platz zum Ausleben findet, nutzt sie diesen gnadenlos aus, springt und tanzt und singt und schreit und hat alle ihre Freunde mitgebracht, die lustigen Worte, die fröhlichen Formulierungen, die wilden Sätze und ihre ganze sonstige Welt, die so heiter und herrlich alles andere überdeckt, in ihrer ganzen Heiter- und Herrlichkeit, aber natürlich nur versehentlich, aus Begeisterung, weil sie nicht anders kann, wie sollte sie auch, und man selbst sitzt dazwischen wie ein Welpe und freut sich natürlich entsprechend auch, weiß aber gleichzeitig nicht ganz, was dort passiert, dort, überall in und um einem, und natürlich spielt und tanzt man mit, aber ganz geheuer ist die Sache nicht, also dem Welpen, der man selbst ist, zumindest in diesem Bild hier.
Plötzlich wird es dann kurz still und man steht da und weiß weder weiter noch sonst wohin, wenn sich in einem der Gedanke bewegt, dass es sich im Jahre 2025 um einen Sommer handeln könnte, in dem einem ein guter Satz, eine gute Formulierung, ein origineller Gedanke mehr im Kopf kleben bleibt als so mancher Tag im Gebirg’. Kann man natürlich nichts mit anfangen, mit so einem Gedanken. Zumindest zunächst nicht. Vielleicht auch später nicht. Aber das muss sich erst noch zeigen.
Sprache.
Dieses unglaublich GEILE Ding. Dieser WAHNSINN (wenn man’s recht anschaut). Dieses Dings, das für so ein unfassbares HIRNGEBRIZZEL sorgen kann.
—
Doch irgendwann beruhigt sich auch das wildeste Gebrizzel wieder. Und ein Funken Klarheit kommt zurück, Vernunft und Deutungswillen im Gepäck, die den ruhigen Augenblick zu nutzen wissen: Vielleicht ist es gerade die aktuelle, die synthetische Zeit, in der die Anpassung ihr Ende findet und sich damit auch alles weitere ein wenig beruhigt.
Schmidt weiß: „Entfernungen sind wie Probleme – sie werden kleiner, wenn man hingeht.“ Und vielleicht sind es ja gerade die ersten Dolomiten-Touren, die dazu hilfreich sind. Vielleicht auch die neue Aufgabe der Redaktion einer großen Alpinpublikation, die Recherchereisen nötig und einen mit vielem Neuen bekannt macht, von dem man noch gar nicht wusste, dass es einen brennend interessiert (Sarntaler Federkielstickerei, z.B.).
Was es auch immer sei: Unendlich dankbar bin ich in jedem Fall Jonas und Kati, die ich in das schönste Kalkriff der Welt und dessen steile Wände begleiten durfte. Zum Beispiel in die „Malsiner/Moroder“ am 4., oder in die „Schober“ und „The Bernhards“ am 1. Sellaturm. Aber auch in die Jori-Kante der Punta Fiames und alles und sonstige, was noch dazwischenlag und öffentliches Licht scheut.
„Es ist zwar regelmäßig ein anderes, aber nicht unbedingt ein schlechtes Leben“, hätte Schmidt womöglich hintangesetzt.
Recht hat er. Wie immer eben.